Fundamentalanalyse
Trailing-Stop erklärt: So funktioniert die dynamische Stop-Loss-Order beim Trading in Deutschland
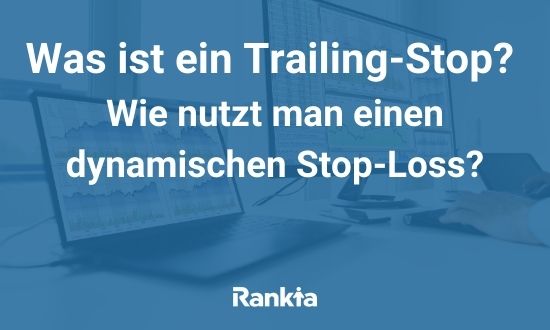
Ein Trailing Stop gehört zu den wichtigsten Instrumenten im Bereich des automatisierten Risikomanagements beim Trading. Ziel ist es, erzielte Gewinne abzusichern und gleichzeitig das Verlustrisiko zu minimieren.
Anders als ein fester Stop-Loss wird der Trailing Stop kontinuierlich an die Kursentwicklung angepasst - ganz ohne manuelles Eingreifen. Bewegt sich der Markt zugunsten Ihrer Position, zieht der Stop automatisch mit. Dreht sich der Trend, bleibt der zuletzt gesetzte Wert bestehen und schützt so vor größeren Rücksetzern.
Im weiteren Verlauf dieses Artikels erhalten Sie eine ausführliche Erklärung zur Funktionsweise eines Trailing Stops, praxisnahe Anwendungsmöglichkeiten für den deutschen Markt sowie eine objektive Einschätzung der Vor- und Nachteile. Darüber hinaus lernen Sie seriöse Broker kennen, die diese Funktion anbieten, und erfahren, welche Aspekte bei der Nutzung besonders beachtet werden sollten.
Was ist ein Trailing Stop (Trailing-Stop-Order)?
Definition und Grundprinzip
Ein Trailing Stop (auch Trailing-Stop-Order genannt) ist eine dynamische Variante des klassischen Stop-Loss, die darauf ausgelegt ist, Gewinne automatisch abzusichern und gleichzeitig das Verlustrisiko zu begrenzen. Im Gegensatz zum festen Stop-Loss, der auf einem fixen Kursniveau verbleibt, passt sich der Trailing Stop automatisch an die Marktbewegung an.
Steigt der Kurs eines Wertpapiers, bewegt sich der Trailing Stop im gleichen Abstand mit nach oben. Fällt der Kurs, bleibt der Stop hingegen auf dem zuletzt erreichten Niveau stehen.
Damit sorgt der Mechanismus dafür, dass bereits erzielte Gewinne geschützt bleiben, ohne dass der Trader ständig selbst eingreifen oder seine Stop-Loss-Marke manuell nachziehen muss.
Das Prinzip lässt sich am besten als eine Art „bewegliches Sicherheitsnetz“ verstehen:
- Es folgt dem Kursverlauf in Trendrichtung (steigend oder fallend),
- friert den Stop-Loss automatisch ein, sobald sich die Richtung umkehrt,
- und begrenzt damit Verluste, während gleichzeitig die Chance auf weitere Gewinne offen bleibt.
Diese Form des Risikomanagements wird vor allem von Tradern geschätzt, die ihre Positionen aktiv managen möchten, aber nicht ständig vor dem Bildschirm sitzen können. Besonders im CFD-, Forex- und Aktienhandel ist der Trailing Stop zu einem Standardinstrument geworden, um systematisch und diszipliniert zu handeln, ohne Emotionen wie Gier oder Angst Entscheidungen beeinflussen zu lassen.
Unterschied zwischen Trailing Stop und klassischem Stop-Loss
Sowohl der klassische Stop-Loss als auch der Trailing Stop dienen demselben Ziel: Verluste begrenzen und Gewinne sichern. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch in ihrer Funktionsweise und Flexibilität.
Ein klassischer Stop-Loss ist ein fester Kurswert, bei dem eine Position automatisch geschlossen wird, sobald der Markt diesen Punkt erreicht. Der Vorteil: Er schützt zuverlässig vor größeren Verlusten. Der Nachteil: Er bleibt statisch - wenn sich der Markt positiv entwickelt, bleibt der Stop auf dem ursprünglichen Niveau und sichert den Gewinn nicht automatisch ab.
Beispiel: Sie kaufen eine Aktie zu 100 € und setzen den Stop-Loss bei 90 €. Steigt der Kurs auf 120 €, bleibt der Stop-Loss trotzdem bei 90 €. Wenn der Kurs dann wieder fällt, wird die Position erst dort geschlossen – die zuvor erzielten Buchgewinne gehen also verloren.
Beim Trailing Stop verhält es sich anders. Hier wird der Stop dynamisch mitgezogen, sobald sich der Kurs zugunsten Ihrer Position entwickelt. Der Abstand zwischen Kurs und Stop bleibt konstant – zum Beispiel 5 % oder ein bestimmter Punktwert.
Steigt der Kurs also von 100 € auf 120 €, verschiebt sich der Stop automatisch von 95 € auf 114 €. Fällt der Kurs anschließend, bleibt der Stop bei 114 € stehen und schützt so einen Teil des Gewinns.
Kurz gesagt:
- Der klassische Stop-Loss schützt vor Verlusten, aber nicht vor dem Verlust bereits erzielter Gewinne.
- Der Trailing Stop sichert beides – er kombiniert Risikobegrenzung und Gewinnsicherung in einem System.
In der Praxis macht dieser Unterschied den Trailing Stop zu einem besonders nützlichen Werkzeug für Trader, die ihre Strategien automatisieren, disziplinierter handeln und psychologische Fehler vermeiden möchten. In einem anderen Artikel haben wir bereits 8 Trading Orderarten zusammengefasst, die wichtig sind.
Für Long- und Short-Positionen geeignet
Ein Trailing Stop lässt sich sowohl bei Long- als auch bei Short-Positionen einsetzen – also unabhängig davon, ob Sie auf steigende oder fallende Kurse spekulieren. Das macht ihn zu einem äußerst flexiblen Instrument im Trading, das in nahezu jeder Marktsituation genutzt werden kann.
Bei einer Long-Position (Kaufposition) liegt der Trailing Stop unterhalb des aktuellen Marktpreises. Wenn der Kurs steigt, zieht der Stop automatisch nach oben mit – in dem von Ihnen gewählten Abstand, etwa 2 % oder 5 %. Sobald sich der Markt dreht und der Kurs fällt, bleibt der Stop auf dem zuletzt erreichten Niveau stehen. Wird dieser Punkt unterschritten, löst der Stop den Verkauf aus und schützt so Ihre Gewinne.
Bei einer Short-Position (Verkaufsposition) funktioniert das Prinzip genau umgekehrt: Hier platzieren Sie den Trailing Stop oberhalb des aktuellen Marktpreises. Wenn der Kurs fällt, bewegt sich der Stop ebenfalls nach unten – also in Richtung Ihres Gewinns. Dreht sich der Markt und steigt wieder, bleibt der Stop auf dem letzten Tiefstand stehen. Sobald dieser überschritten wird, schließt sich die Position automatisch.
Das folgende Schema verdeutlicht den Unterschied:
| Long-Position | Kurs steigt | Nach oben | Bleibt beim letzten Höchststand | ||||
| Short-Position | Kurs fällt | Nach unten | Bleibt beim letzten Tiefstand |
| Positionstyp | Kursrichtung | Bewegung des Trailing Stops | Fixierung bei Trendwende |
|---|---|---|---|
| Long-Position | Kurs steigt | Nach oben | Bleibt beim letzten Höchststand |
| Short-Position | Kurs fällt | Nach unten | Bleibt beim letzten Tiefstand |
Diese Funktionsweise macht den Trailing Stop besonders interessant für aktive Trader, die in volatilen Märkten agieren. Egal ob im Forex-, CFD- oder Aktienhandel – der Trailing Stop ermöglicht es, Gewinne automatisch laufen zu lassen, ohne dabei den Markt permanent überwachen zu müssen.
Gerade im kurzfristigen Handel (Day- oder Swing-Trading) ist diese Orderart beliebt, weil sie Disziplin und Automatisierung vereint: Der Markt entscheidet, wann Gewinne realisiert werden, nicht die Emotion des Traders.
Wie funktioniert eine Trailing-Stop-Order in der Praxis?
Ein Trailing Stop funktioniert auf den ersten Blick ähnlich wie ein klassischer Stop-Loss – mit einem entscheidenden Unterschied: Der Stop bewegt sich automatisch mit dem Kurs, solange sich dieser in die gewünschte Richtung entwickelt. Das bedeutet, Sie müssen den Stop-Loss nicht manuell anpassen, sondern legen zu Beginn nur den Abstand (das sogenannte „Trailing“) zwischen Kurs und Stop fest.
Dynamische Anpassung an den Kursverlauf
Das Grundprinzip ist einfach:
- Bei einer Long-Position wird der Trailing Stop unterhalb des Marktpreises platziert.
- Bei einer Short-Position entsprechend oberhalb des Marktpreises.
Steigt der Kurs (bei einer Long-Position), zieht der Trailing Stop automatisch mit. Der festgelegte Abstand – etwa 2 %, 3 % oder 50 Punkte – bleibt dabei konstant. Sobald der Kurs fällt, bleibt der Stop stehen und löst aus, wenn der Markt dieses Niveau erreicht.
So können Trader Gewinne automatisch sichern, ohne bei jeder Bewegung reagieren zu müssen.
Diese Mechanik ermöglicht es, in Trendphasen die Gewinne auszubauen, während man gleichzeitig vor plötzlichen Gegenbewegungen geschützt bleibt. Gerade in volatilen Märkten wie Forex, Indizes oder Kryptowährungen kann dieser Mechanismus entscheidend sein, um den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Trade und einem verpassten Gewinn zu machen.
Kauforder und Verkaufsorder - so unterscheiden sie sich
- Bei Kaufpositionen (Long): Der Trailing Stop liegt unterhalb des Marktpreises und folgt dem Kurs nach oben. Sobald der Kurs fällt und den Stop erreicht, wird verkauft.
- Bei Verkaufspositionen (Short): Der Trailing Stop liegt oberhalb des Marktpreises und folgt dem Kurs nach unten. Wenn der Kurs wieder steigt, löst der Stop einen Rückkauf aus.
So arbeitet der Trailing Stop in beide Richtungen – er schützt Gewinne, egal ob Sie auf steigende oder fallende Märkte setzen.
Beispiel: Trailing Stop Schritt für Schritt erklärt
Angenommen, Sie kaufen eine Aktie zu 100 €. Sie setzen einen Trailing Stop mit 5 % Abstand.
- Zu Beginn liegt Ihr Stop also bei 95 €.
- Steigt der Kurs auf 110 €, zieht der Stop automatisch auf 104,50 € mit.
- Fällt der Kurs anschließend, bleibt der Stop auf diesem Niveau stehen.
- Sobald der Kurs 104,50 € erreicht, wird Ihre Position automatisch verkauft.
Der Vorteil: Sie müssen nicht selbst aktiv werden. Der Markt sichert Ihnen den Gewinn, während der Stop die Position schließt, sobald sich der Trend umkehrt.
Diese Logik macht den Trailing Stop zu einem intelligenten Instrument des modernen Risikomanagements. Viele Trader nutzen ihn, um emotionale Fehler zu vermeiden, denn die Entscheidung, wann verkauft wird, trifft nicht mehr das Bauchgefühl, sondern eine klare Regel.
Vorteile und Chancen des Trailing-Stops
Der Trailing Stop zählt zu den effektivsten Werkzeugen im modernen Trading, weil er Risikobegrenzung und Gewinnsicherung automatisch miteinander kombiniert. Während klassische Stop-Loss-Marken oft manuell angepasst werden müssen, übernimmt der Trailing Stop diese Arbeit selbstständig – und reagiert dynamisch auf Kursveränderungen. Das bringt eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich.
Automatischer Gewinnschutz bei steigenden Kursen
Einer der größten Pluspunkte des Trailing Stops ist sein automatischer Charakter:
Sobald sich der Kurs zugunsten Ihrer Position entwickelt, zieht der Stop nach und sichert den Gewinn.
Damit können Trader von laufenden Trends profitieren, ohne ständig selbst eingreifen zu müssen. Wird der Markt unruhig oder dreht sich der Trend, bleibt der Stop auf dem letzten Höchststand stehen und schützt die bereits erzielte Rendite.
Dieses automatische Nachziehen ist besonders hilfreich in Phasen hoher Dynamik – etwa nach wirtschaftlichen Nachrichten oder bei volatilen Aktien –, weil der Mechanismus die Gewinne automatisch einfängt, bevor sie wieder verloren gehen.
Emotionen aus dem Trading nehmen
Der Trailing Stop ist nicht nur ein technisches, sondern auch ein psychologisches Hilfsmittel. Viele Anleger scheitern nicht an ihrer Strategie, sondern an Emotionen wie Angst, Gier oder Ungeduld.
Ein fester Stop-Loss wird oft zu früh nach oben oder unten verschoben, weil der Trader „mehr herausholen“ oder „noch etwas abwarten“ will. Der Trailing Stop eliminiert dieses Problem:
Er folgt einer klaren Regel, die nicht von Gefühlen beeinflusst wird.
Dadurch entsteht ein disziplinierter, systematischer Handelsansatz, der langfristig bessere Ergebnisse liefert – gerade für Trader, die zu impulsiven Entscheidungen neigen oder nicht ständig den Markt überwachen können.
Weitere Vorteile auf einen Blick
- Effizientes Risikomanagement: Der Trailing Stop schützt nicht nur vor Verlusten, sondern bewahrt auch bereits erzielte Gewinne – ein entscheidender Faktor für nachhaltigen Trading-Erfolg.
- Keine ständige Marktbeobachtung nötig: Besonders für Berufstätige oder Teilzeit-Trader ideal, die nicht jede Kursbewegung verfolgen können.
- Disziplin und Regelmäßigkeit: Der Einsatz klarer Regeln schafft Konsistenz im Trading und verhindert emotionale Fehlentscheidungen.
- Universell einsetzbar: Funktioniert in allen Anlageklassen – Aktien, Forex, Indizes, Rohstoffe oder Kryptowährungen.
- Kombinierbar mit anderen Ordertypen: Lässt sich problemlos mit Limit-Orders oder Take-Profits kombinieren, um Strategien weiter zu verfeinern.
Kurz gesagt:
Ein Trailing Stop hilft Tradern, ihre Gewinne zu maximieren und ihre Risiken zu minimieren, ohne dass sie aktiv eingreifen müssen. Genau das macht ihn zu einem der beliebtesten Werkzeuge für professionelles und diszipliniertes Trading.
Risiken und Nachteile beim Trailing Stop
So praktisch und intelligent ein Trailing Stop auch ist – er ist kein Allheilmittel.
Wie bei jedem Ordertyp gibt es auch hier Risiken und Schwächen, die man kennen sollte, bevor man ihn einsetzt.
Wer die Mechanik falsch anwendet oder den Abstand unpassend wählt, kann schnell das Gegenteil von dem erreichen, was eigentlich beabsichtigt war: unnötige Verkäufe, verpasste Gewinne oder zu frühe Ausstiege.
Zu enger Trailing-Abstand - häufige Auslösung
Der häufigste Fehler im Umgang mit dem Trailing Stop ist ein zu kleiner Abstand zwischen Kurs und Stop.
Wenn der Abstand zu eng gewählt wird (z. B. nur 1–2 %), kann bereits eine normale Marktbewegung oder ein kurzfristiges „Rauschen“ den Stop auslösen.
Das Ergebnis:
Die Position wird geschlossen, obwohl sich der übergeordnete Trend gar nicht verändert hat.
Gerade bei volatilen Märkten – wie Kryptowährungen oder kleinen Nebenwerten – sollte der Abstand also etwas großzügiger gewählt werden. Ein zu enger Stop schneidet dem Trade sprichwörtlich die Luft ab.
Zu weiter Abstand – unzureichender Schutz
Das andere Extrem ist ein zu großer Abstand.
Wenn der Trailing Stop zu weit vom aktuellen Kurs entfernt liegt, bietet er kaum Schutz:
Fällt der Kurs stark, ist der Verlust entsprechend groß, bevor der Stop überhaupt greift.
Die Kunst liegt also darin, das richtige Maß zu finden – ein Abstand, der genug Raum für natürliche Schwankungen lässt, aber dennoch effektiv schützt.
Viele erfahrene Trader orientieren sich dabei an der Volatilität des Marktes (zum Beispiel mit dem ATR-Indikator), um den idealen Abstand zu bestimmen.
Volatile Märkte und Slippage-Risiken
Ein weiteres Risiko beim Trailing Stop ist die Ausführung in sehr schnellen Marktphasen.
Wenn der Kurs plötzlich stark springt – etwa nach Nachrichten oder während der Eröffnung – kann es vorkommen, dass der Stop nicht exakt zum gewünschten Preis ausgeführt wird.
Diese Differenz nennt man Slippage.
Das bedeutet: Der tatsächliche Verkaufspreis kann leicht unter (oder über, bei Shorts) dem Stop-Niveau liegen.
Das ist kein technischer Fehler, sondern schlicht ein Marktphänomen.
Vor allem im außerbörslichen Handel oder bei gering liquiden Werten kann Slippage stärker ausfallen.
Trailing Stop außerhalb der Handelszeiten
Ein oft übersehener Punkt:
Nicht alle Broker aktivieren Trailing Stops auch außerhalb der regulären Handelszeiten.
Wenn der Markt beispielsweise über Nacht oder am Wochenende große Kurslücken („Gaps“) bildet, kann der Stop erst bei Marktöffnung greifen – und dann deutlich schlechtere Kurse auslösen.
Deshalb sollten Trader genau prüfen, wann und wie ihr Broker Trailing Stops umsetzt, und gegebenenfalls zusätzliche Schutzmechanismen (z. B. garantierte Stop-Loss-Orders) nutzen.
Strategie & Tipps für den Einsatz eines Trailing Stops
Ein Trailing Stop ist mehr als nur ein Schutzmechanismus – er kann auch ein strategisches Werkzeug sein, um Positionen intelligent zu managen und Gewinne zu optimieren. Entscheidend ist, wie man ihn einsetzt. Der richtige Abstand, der passende Zeitpunkt und die Kombination mit anderen Ordertypen bestimmen, ob der Trailing Stop zu einem echten Vorteil wird oder eher hinderlich wirkt.
Wie den optimalen Trailing-Abstand wählen
Der wichtigste Erfolgsfaktor ist der richtige Abstand zwischen Kurs und Trailing Stop.
Dieser sollte so gewählt werden, dass er dem Markt genug Bewegungsfreiheit lässt, aber dennoch vor größeren Rücksetzern schützt.
Die optimale Distanz hängt von drei Faktoren ab:
- Volatilität des Basiswerts: Bei ruhigen Märkten (z. B. DAX-Aktien) können Abstände von 2–3 % sinnvoll sein. Bei volatilen Märkten wie Kryptowährungen oder Nebenwerten sind oft 5–10 % angebracht.
- Handelsstrategie: Daytrader arbeiten meist mit engen Stops, um schnell zu reagieren. Swing-Trader oder langfristig orientierte Anleger bevorzugen größere Abstände.
- Zeitrahmen: Je länger die Position gehalten wird, desto mehr Raum sollte der Kurs haben, sich zu entwickeln.
Viele Trader nutzen zur Orientierung den Average True Range (ATR), einen Volatilitätsindikator, um den idealen Abstand objektiv zu bestimmen.
Beispiel: Beträgt der ATR einer Aktie 2 €, könnte ein Trailing-Abstand von etwa 2–2,5 × ATR sinnvoll sein.
Kombinieren mit anderen Ordertypen (z. B. Stop Limit, Bracket Order)
Ein Trailing Stop lässt sich hervorragend mit anderen Orderarten kombinieren, um das Risikomanagement zu perfektionieren.
Beispiele:
- Stop-Limit-Order: Hier wird festgelegt, dass der Verkauf nur bis zu einem bestimmten Mindestkurs erfolgt – nützlich, um ungewollte Slippage zu vermeiden.
- Bracket-Order: Diese kombiniert eine Take-Profit- und eine Stop-Loss-Order (oft inklusive Trailing Stop), sodass Gewinnziel und Verlustbegrenzung automatisch festgelegt werden.
- Take-Profit + Trailing Stop: Während der Take-Profit feste Gewinnziele absichert, lässt der Trailing Stop zusätzliche Kurssteigerungen zu – eine ideale Kombination für Trendmärkte.
Solche Setups sind besonders effektiv, wenn sie automatisiert über die Handelsplattform eingerichtet werden. So bleibt Ihre Strategie konsistent und diszipliniert, selbst wenn Sie nicht aktiv vor dem Bildschirm sitzen.
Beispiel für eine Einsteigerstrategie mit Trailing Stop
Einsteiger können den Trailing Stop ideal in Verbindung mit Breakout-Strategien einsetzen.
Dabei wird eine Position eröffnet, sobald der Kurs aus einer Seitwärtsphase oder über einen wichtigen Widerstand ausbricht.
Ein einfaches Beispiel:
Sie kaufen die Siemens-Aktie bei 130 €. Ihr Plan: den Aufwärtstrend mitnehmen, aber das Risiko begrenzen.
- Sie setzen einen Trailing Stop von 3 % unterhalb des Marktpreises.
- Steigt die Aktie auf 140 €, zieht der Stop automatisch auf 135,80 € nach.
- Fällt der Kurs anschließend, wird bei 135,80 € verkauft – Ihr Gewinn ist gesichert.
Der Vorteil: Sie müssen weder aktiv mitverfolgen noch emotional entscheiden, wann Sie aussteigen.
Der Markt erledigt das für Sie – mit klaren, vorher definierten Regeln.
Gerade für Anfänger bietet dieser Ansatz eine hervorragende Möglichkeit, Trading-Disziplin zu trainieren und Verlustphasen zu verkürzen, ohne auf Chancen verzichten zu müssen.
Trailing Stop in Deutschland: Bei welchen Brokern verfügbar?
Der Trailing Stop ist heute bei den meisten modernen Online-Brokern verfügbar – allerdings nicht bei allen im gleichen Umfang oder für jedes Produkt. Während einige Anbieter die Funktion direkt in der Standard-Ordermaske integriert haben, ist sie bei anderen nur in bestimmten Handelsmodi oder für ausgewählte Instrumente (z. B. CFDs oder Forex) aktivierbar.
In Deutschland und Europa gehören die folgenden Broker zu den bekanntesten Plattformen, die Trailing Stops zuverlässig unterstützen und mit stabilen Handelsumgebungen überzeugen:
| XTB | BaFin / KNF (EU) | ✅ Ja | Intuitive Plattform (xStation), schnelle Orderausführung, ideal für CFD- und Forex-Trader | ||||
| eToro | CySEC / BaFin (EU) | ✅ Ja | Social Trading + CopyPortfolios, Trailing Stop bei CFD-Positionen verfügbar | ||||
| Trade Republic | BaFin | ✅ Eingeschränkt | Trailing Stop bei bestimmten Orderarten verfügbar, sehr einfache mobile Bedienung | ||||
| Interactive Brokers (IBKR) | SEC / BaFin | ✅ Ja | Professionelle Plattform mit breiter Orderauswahl, ideal für erfahrene Trader | ||||
| Capital.com | CySEC / FCA / ASIC | ✅ Ja | KI-gestützte Oberfläche, flexible Ordertypen inklusive Trailing Stop | ||||
| ActivTrades | FCA / CSSF / BaFin | ✅ Ja | Professionelle Handelsplattform, enge Spreads und ausgefeilte Risikomanagement-Tools |
| Broker | Regulierung | Trailing Stop verfügbar | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| XTB | BaFin / KNF (EU) | ✅ Ja | Intuitive Plattform (xStation), schnelle Orderausführung, ideal für CFD- und Forex-Trader |
| eToro | CySEC / BaFin (EU) | ✅ Ja | Social Trading + CopyPortfolios, Trailing Stop bei CFD-Positionen verfügbar |
| Trade Republic | BaFin | ✅ Eingeschränkt | Trailing Stop bei bestimmten Orderarten verfügbar, sehr einfache mobile Bedienung |
| Interactive Brokers (IBKR) | SEC / BaFin | ✅ Ja | Professionelle Plattform mit breiter Orderauswahl, ideal für erfahrene Trader |
| Capital.com | CySEC / FCA / ASIC | ✅ Ja | KI-gestützte Oberfläche, flexible Ordertypen inklusive Trailing Stop |
| ActivTrades | FCA / CSSF / BaFin | ✅ Ja | Professionelle Handelsplattform, enge Spreads und ausgefeilte Risikomanagement-Tools |
Was unterscheidet diese Broker im Detail?
- ActivTrades bietet ein sehr präzises Ordermanagement, das sich besonders an erfahrene Trader richtet. Die Trailing-Stop-Funktion kann individuell eingestellt und mit anderen Stop-Varianten kombiniert werden.
- XTB bietet eine der benutzerfreundlichsten Oberflächen für den Einsatz von Trailing Stops. Besonders beliebt ist die Plattform bei CFD- und Forex-Tradern, die mit engen Spreads und klaren Risikoparametern arbeiten möchten.
- eToro überzeugt durch seine Social-Trading-Funktion, mit der man Strategien anderer Trader automatisch kopieren kann – inklusive Trailing Stop in CFD-Trades. Die Kombination aus einfacher Oberfläche und Transparenz macht eToro besonders einsteigerfreundlich.
- Trade Republic ist vor allem bei Privatanlegern beliebt, die mobil handeln. Hier ist der Trailing Stop zwar nur in bestimmten Ordermasken verfügbar, aber für Einsteiger eine einfache Möglichkeit, Positionen automatisch abzusichern.
- Interactive Brokers (IBKR) gilt als Profi-Plattform: Der Broker bietet nahezu alle denkbaren Ordertypen, inklusive komplexer Varianten des Trailing Stops. Besonders interessant ist IBKR für Trader, die internationale Märkte aktiv handeln.
- Capital.com kombiniert ein modernes Design mit lernorientierten Tools und automatisierten Ordertypen. Der Trailing Stop lässt sich in der Plattform direkt anpassen und ist auch bei kleineren Positionen verfügbar.
Tipps vor dem Setzen einer Trailing-Stop-Order
Ein Trailing Stop entfaltet sein volles Potenzial nur dann, wenn er richtig eingestellt und strategisch eingesetzt wird.
Viele Trader unterschätzen dabei, wie stark Faktoren wie Volatilität, Handelszeit oder Marktliquidität die Wirksamkeit beeinflussen können.
Die folgenden Tipps helfen Ihnen, den Trailing Stop optimal zu nutzen und typische Fehler zu vermeiden.
1. Marktliquidität und Volatilität beachten
Bevor Sie eine Trailing-Stop-Order setzen, sollten Sie die Volatilität und Liquidität des gewählten Basiswerts genau prüfen.
- In sehr volatilen Märkten (z. B. Kryptowährungen, Nebenwerte) kann ein zu enger Abstand dazu führen, dass Ihre Position bei jeder kleinen Kursbewegung geschlossen wird.
- In stabilen Märkten (z. B. große Aktienindizes oder Blue Chips) kann ein engerer Stop dagegen sinnvoll sein, um Gewinne enger abzusichern.
Eine gute Orientierung bietet der Average True Range (ATR-Indikator), der die durchschnittliche Schwankungsbreite eines Kurses misst. Viele professionelle Trader passen ihren Trailing-Abstand an die aktuelle Marktvolatilität an, um unnötige Auslösungen zu vermeiden.
2. Trailing-Abstand regelmäßig überprüfen
Der Trailing Stop ist kein „Set and Forget“-Instrument.
Auch wenn er automatisch arbeitet, sollte der Abstand regelmäßig überprüft werden - besonders bei längeren Haltezeiten oder nach wichtigen Marktbewegungen.
- Wenn der Markt ruhiger wird, kann der Abstand verkleinert werden, um Gewinne enger zu sichern.
- Wenn die Volatilität steigt, sollte der Abstand vergrößert werden, damit die Position nicht zu früh geschlossen wird.
Ein regelmäßiger Check - etwa einmal pro Woche oder nach wichtigen Wirtschaftsdaten - sorgt dafür, dass der Trailing Stop optimal an Ihre Marktbedingungen angepasst bleibt.
3. Einsatz je nach Handelsstrategie anpassen
Nicht jede Strategie profitiert gleichermaßen von einem Trailing Stop.
- Trendfolgende Trader nutzen ihn, um laufende Gewinne systematisch mitzunehmen, während der Markt weiterläuft.
- Swing-Trader oder Positions-Trader verwenden größere Abstände, um längere Bewegungen auszunutzen.
- Daytrader hingegen wählen enge Abstände, um kurzfristige Schwankungen auszunutzen, aber schnelle Ausführungen zu gewährleisten. Hierzu haben wir bereits einen passenden Artikel verfasst: Daytrading Broker Vergleich
Auch hier gilt: Testen Sie verschiedene Einstellungen im Demokonto, bevor Sie echtes Kapital einsetzen. Die optimale Einstellung hängt nicht nur vom Markt, sondern auch vom persönlichen Risikoempfinden ab.
4. Nachrichten und Handelszeiten im Blick behalten
Wichtige Unternehmensmeldungen, Zinsentscheidungen oder Wirtschaftsdaten können starke Kursbewegungen auslösen.
Gerade in diesen Phasen ist Vorsicht geboten:
Ein zu enger Trailing Stop kann ausgelöst werden, noch bevor sich ein klarer Trend etabliert hat.
Auch außerhalb der regulären Handelszeiten (z. B. über Nacht oder am Wochenende) kann es zu Kurslücken kommen, bei denen der Stop erst verzögert greift.
Wenn Sie vermeiden möchten, dass ein Stop während solcher Ereignisse aktiviert wird, können Sie den Abstand temporär vergrößern oder die Order anpassen.
💡 Profi-Tipp:
Kombinieren Sie den Trailing Stop mit technischer Analyse - etwa Unterstützungs- und Widerstandszonen oder gleitenden Durchschnitten.
Wenn Sie den Stop unterhalb einer klaren Unterstützung (oder oberhalb eines Widerstands bei Shorts) platzieren, erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass er nur bei echten Trendwenden ausgelöst wird – nicht bei kleinen Korrekturen.
Fazit
Der Trailing Stop ist eines der intelligentesten Werkzeuge im modernen Trading.
Er kombiniert Sicherheit und Flexibilität, indem er automatisch Gewinne absichert, während er dem Markt genug Raum lässt, sich weiter in die gewünschte Richtung zu entwickeln. Damit ist er eine ideale Lösung für Trader, die systematisch handeln und gleichzeitig emotionale Entscheidungen vermeiden möchten.
Wer ihn richtig einsetzt, profitiert gleich doppelt:
Zum einen schützt der Trailing Stop vor unerwarteten Rücksetzern, zum anderen lässt er Gewinne „laufen“, ohne dass man den Markt permanent beobachten muss. So entsteht eine Balance zwischen Kontrolle und Freiheit – ein wichtiger Faktor für langfristigen Erfolg an den Finanzmärkten.
Wichtig ist allerdings, den Trailing Stop nicht blind einzusetzen, sondern ihn an Marktvolatilität, Zeitrahmen und Strategie anzupassen. Der richtige Abstand entscheidet über den Erfolg:
- Zu eng – der Trade wird zu früh geschlossen.
- Zu weit – das Risiko steigt, bevor der Schutz greift.
Gerade für Einsteiger empfiehlt es sich, verschiedene Einstellungen zunächst in einem Demokonto zu testen. So lässt sich schnell herausfinden, welche Kombination aus Abstand und Strategie am besten zum eigenen Handelsstil passt. Dazu haben wir ebenfalls einen passenden Artikel: Trading Demokonten im Vergleich.